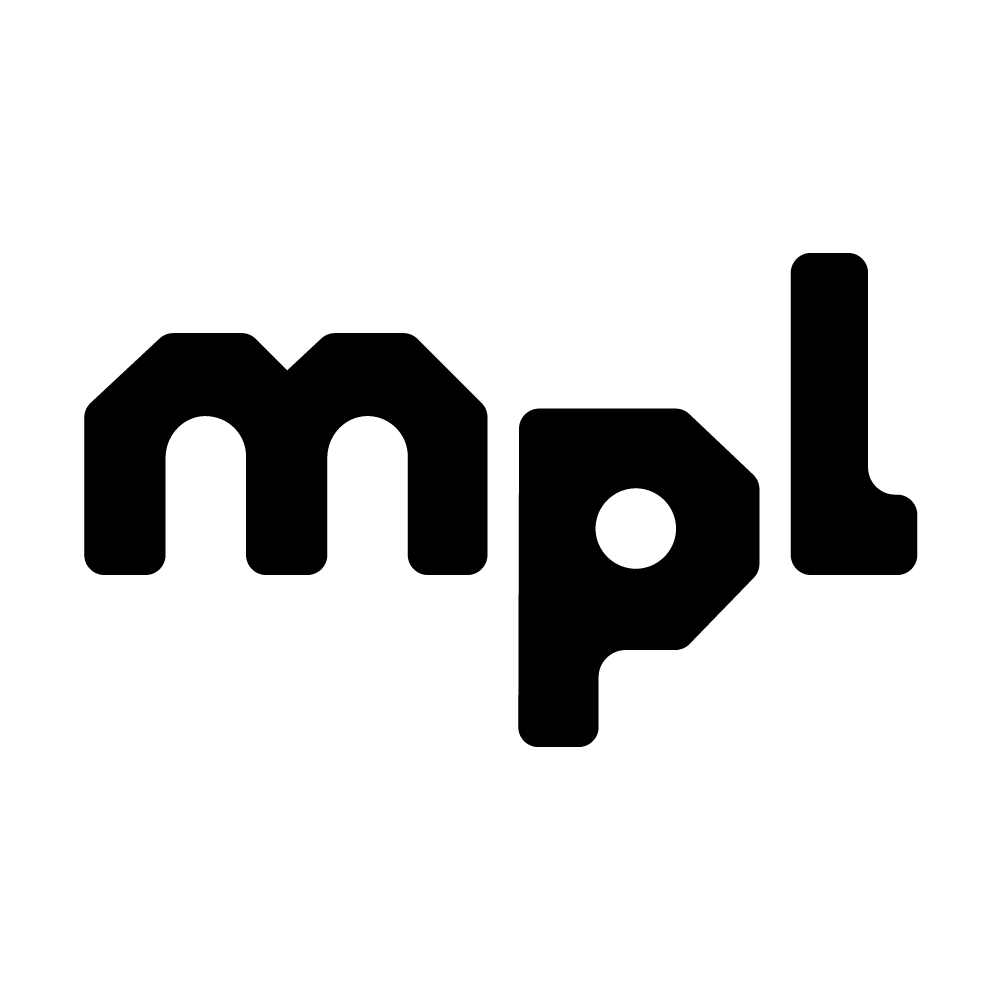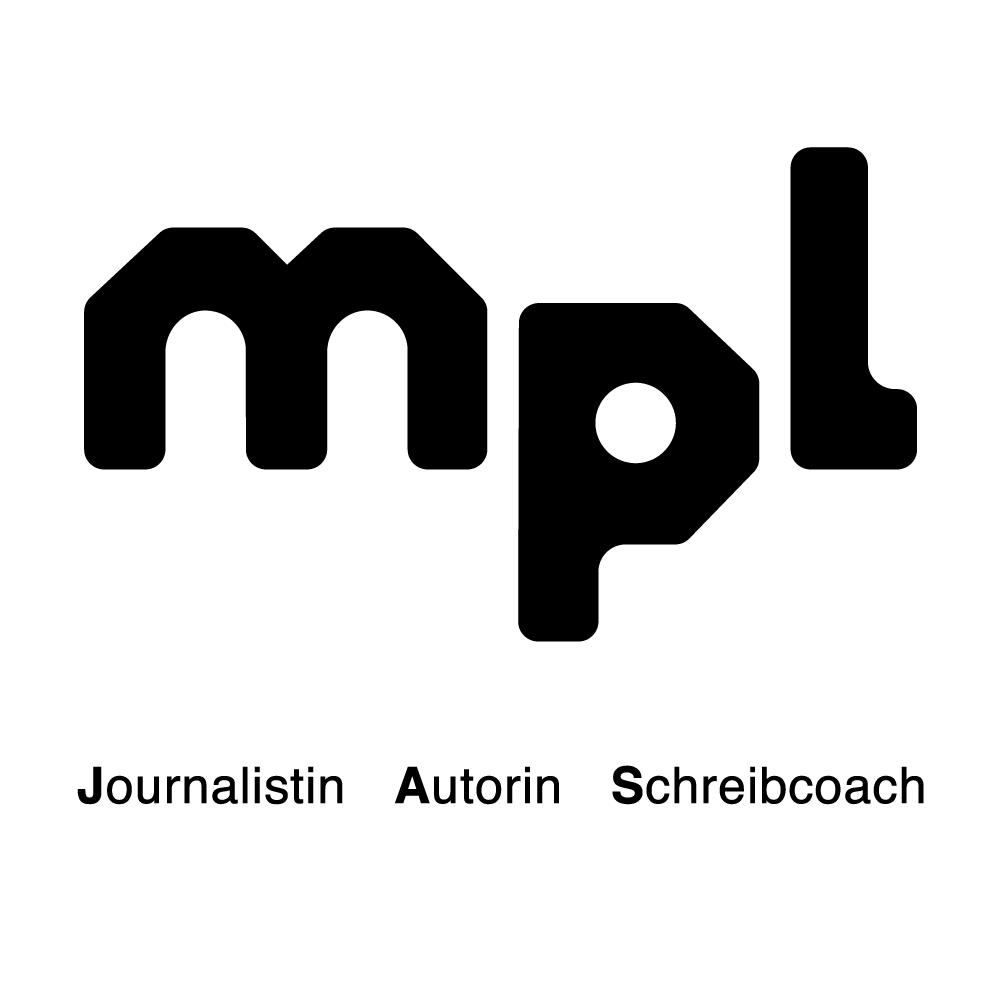Dreimal: Feridun Zaimoglu in Mainz
Feridun Zaimoglu über die Bücher seines Lebens
Wer weit reisen will, aber nicht fliegen mag, sitzt viel in der Bahn. Wer Bücher schreibt, aber keinen Computer möchte, muss auf unbequemen Tasten tippen. Beide Entscheidungen rauben Zeit – oder schenken sie. Je nach Sichtweise. Der neue Mainzer Stadtschreiber Feridun Zaimoglu hat sich für die jeweils ruhigere Gangart entschieden. Und das scheint ihm genau die Freiräume zu verschaffen, die er benötigt, um sich ganz der Sprache hinzugeben und ihren Wert zu verfechten. Viel Bemerkenswertes über den Autor und sein Verhältnis zur Kraft des gedruckten Wortes durfte das Publikum bei der Aufzeichnung der SWR-Sendung „lesenswert“ erfahren.
Zaimoglu brauchte von seiner Stadtschreiberwohnung nur einen kurzen Fußmarsch entlang des Rheines zurückzulegen. „Mainz ist wirklich gut“, verrät er Moderatorin Felicitas von Lovenberg im lockeren Plausch beim Soundcheck. Und dass er Gartenzwerge sammelt. „Die grimmigen, nicht die mit den freundlichen Gesichtern.“ Drei Bücher, die sein Leben prägten, hat Feridun Zaimoglu mitgebracht. Aus allen strotzt die Kraft der Sprache. Und so wie Zaimoglu die Literatur, die andere auf ihren Schreibmaschinen geschrieben haben, mit biografischen Anekdoten aus seinem Leben verknüpft, erlebt das Publikum eine regelrechte Verneigung des Schriftstellers vor der Kunst der ungekünstelten Sprache.
Aufgewachsen im Arbeitermilieu des Münchner Stadtteils Moosach, hat es ihn als Kind regelmäßig in die Bücherei verschlagen. Die Bücher dort eröffneten ihm „eine magische Welt“. Sein Lieblingsband: „Bauernregeln, Bauernweisheiten, Bauernsprüche“ von Georg Haddenbach. „Das waren großartige deutsche Worte mit Klang. Eine Sprache, die mir sofort gefiel.“ In der archaischen Stärke der Bauernregeln fand er einen Spiegel für sein Kinderleben im Stadtteil. „Da war eine Welt, die Worte fand, für das, was wir erlebten und wir erleben wollten“.
Jahre später, anderes Buch. Während einer Recherchereise in Budapest waren es Wolf Wondratscheks Gedichte in „Die Einsamkeit der Männer“. Von denen fühlte er sich „beglückt wie ein Kind“. Als Machobuch habe er den Gedichtband nie gelesen. Und überhaupt, was bedeutet das, männlich zu sein? „Keine Ahnung, was das ist.“
Mit dem weniger bekannten Lyriker Thomas Kunst verbrachte Zaimoglu einen Aufenthalt in der Villa Massimo in Rom. Dessen Gedichtband „Was wäre ich am Fenster ohne Wale“ hat ihn nach einer durchfeierten Nacht umgehauen. „Ich kann keine Gedichte schreiben“, gibt er zu. Umso größer die Begeisterung für den verkannten Poeten Thomas Kunst. „Keine Bastelkunst, keine experimentelle Angeberlyrik, ich war ergriffen.“ (für Allgemeine Zeitung Mainz, Februar 2015)
"Istanbul von vorne" – Zaimoglus Abschied aus Mainz
Das Taxi, ein riesiges Blechungetüm aus anderen Zeiten, bahnt sich seinen Weg durch die engen Gassen des Istanbuler Armeleuteviertels Yedikule – „Siebentürme“. An der verlassenen Straße wartet der Schriftsteller und Maler Feridun Zaimoglu auf die Ankunft seiner Eltern. Der vornehme ältere Herr und die schöne elegante Dame haben das Viertel vor 50 Jahren mit ihrem kleinen Sohn in Richtung Deutschland verlassen. Dort, in München und Berlin, haben sie ihren Kindern beigebracht, „Deutsche zu sein, die ihre Muttersprache noch finden müssen“. Für den Film „Istanbul von vorne – Eine Recherche“ haben sie sich hier wieder verabredet, wo die Reise begann.
Zaimoglu trägt der sengenden Hitze zum Trotz schwarze Hose und schwarzes Jackett, hat zwei Tage und zwei Nächte Anreise über Land im Bus hinter sich. Mutter und Vater, die wieder in der Türkei leben und von ihm hochverehrt werden, „ich sieze meine Eltern“, hat er einige Jahre nicht gesehen. Im Viertel war er zuletzt vor vier Jahren, um für seinen im 2. Weltkrieg angesiedelten Roman „Siebentürmeviertel“ der Atmosphäre nachzuspüren.
„Ich wollte in Istanbul nicht wie ein Hippie im Hemd auftreten“, sagt Zaimoglu am Donnerstagabend bei der Vorpremiere des gut 30-minütigen Kurzfilms, den er als 31. Mainzer Stadtschreiber in Zusammenarbeit mit dem ZDF im Sommer in Istanbul gedreht hat. Hier ist er geboren. Das Wort „Heimatstadt“ allerdings strapaziert der Film an keiner Stelle. „Ich bewege mich durch Istanbul bestenfalls wie ein gut unterrichteter Tourist“. Heimat, das ist Deutschland, „und jetzt auch Mainz“. Als an den Menschen interessierter hat er mit Werner von Bergen, dem leitenden Redakteur, zwei Wochen lang dem Phänomen einer Stadt hinterher gespürt, die irgendwie zwischen den Zeiten stecken geblieben scheint. Hier tobt die Abrissbirne sich an historischen Holzhäusern aus, lässt bestenfalls noch die osmanischen Fassaden stehen, dort werden gläserne Bürotürme und sterile Wohnsiedlungen hochgezogen.
„Vorsicht, gleich kommt John Wayne ums Eck“, sagt einer beim Rundgang durch Sulukule, dem über 1000 Jahre alten Romaviertel. Von den ursprünglichen Bewohnern keine Spur mehr, sie passten nicht länger in die schicken Vorhaben der Stadtplaner. Ara Güler, der alte Mann im Kaffeehaus, kann über die neuen Zeiten nur noch müde lachen. Mit seiner Leica hat er die Stadt jahrzehntelang in schwarz-weiß porträtiert und ist damit weltberühmt geworden.
„Dies ist eine Geschichte vom Verschwinden“, sagt Zaimoglu. Die Bilder, die er vom Basar, der Hafenrundfahrt oder aus den alten Stadtteilen zeigt, wirken zwar wie von fern hergeholt, aber niemals nostalgisch verklärt. „Wir haben eine unschuldige Zeit in Istanbul verbracht, aber am Rand franste es, an den Rändern flackerte es bereits, etwas dräute“, erinnert er sich an die Drehtage und erzählt von den beiden syrischen Flüchtlingen, die sich regelmäßig zum Fischen auf der Brücke verabredeten. Vielleicht leben sie jetzt in Yedikule, dem Viertel der Einwanderer. „Wir haben Menschen getroffen, aber ihr Vertrauen niemals ausgenutzt“. Freie Meinungsäußerung ist im Istanbul der Makler und Spekulanten nicht selbstverständlich, auch das schwingt mit.
Feridun Zaimoglu ist ein wunderbarer Erzähler und vollendet höflicher Mensch. „Dieser Film konnte nur gelingen, weil man mir den Weg ausgeleuchtet hat“, winkt er bescheiden ab. Und betont abermals, „Istanbul von vorne“ sei kein Film zum Roman, wenngleich er sich ein bisschen als Handlanger seines Protagonisten „Wolf“ fühle.
(für Allgemeine Zeitung Mainz, Oktober 2015)
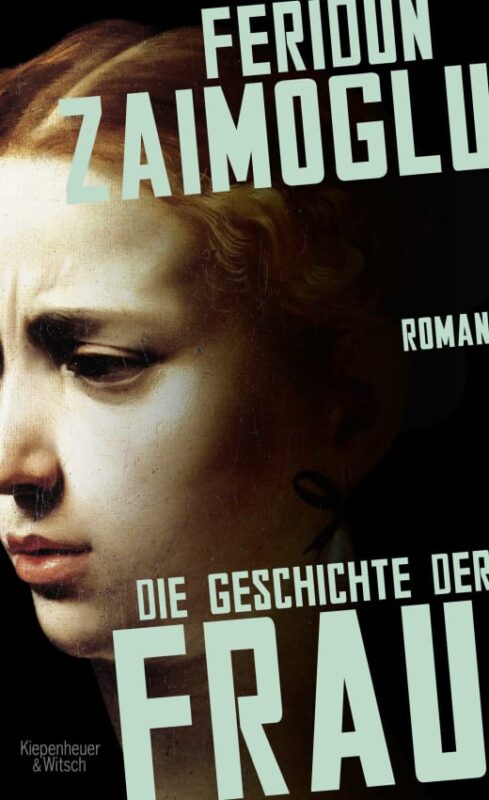
Brunhild eine Verbalfurie?
Feridun Zaimoglu, vor vier Jahren Mainzer Stadtschreiber, ist ein produktiver und sprachgewaltiger Schriftsteller. Für sein jüngst bei Kiepenheuer und Witsch erschienenes Buch „Die Geschichte der Frau“, hat er von der Literaturkritik Verrisse bis zur Schmerzgrenze einstecken müssen. Dafür, dass seine zehn Monologe von Frauen der Menschheitsgeschichte konsequent aus Frauensicht verfasst sind, sie als „Feministisches Manifest“ beworben werden und, für den altertümlich „hochsprachlichen“ Ton, den er den Frauen vom Alten Testament bis in die 1970er Jahre nahezu schattierungslos in den Mund gelegt hat.
In der Aufzeichnung der Sendung SWR 2 „Lesenswert Gespräch“, erklärte Zaimoglu Moderator Alexander Waser, warum er Frauen nicht nur irgendeine, sondern genau diese Stimme geben musste.
Die Aneignung von Biografien, Kultur und Geschlecht ist ein derzeit heiß diskutiertes Thema. Kritik hagelte es zuletzt für Takis Würger und seinen Roman „Stella“, und auch Theaterschaffende sind permanent aufgefordert, Aneignungsprozesse der tradierten Aufführungspraxis zu überdenken und umgehen. Wie legitim ist es also, wenn ein Schriftsteller von sich selbst behauptet, beim Schreiben auf Papier nicht als „Stimmenimitator auf Rollenpose“ unterwegs gewesen zu sein, sondern eine regelrechte Verschmelzung mit seinen Frauenfiguren herbeigeführt zu haben. „Es ist tatsächlich so, dass ich Brunhild bin“.
Angefangen bei der Ehefrau von Moses über Antigone und Brunhild bis zu Valerie Solanas, „Radikalfeministin“, „Warhol-Attentäterin“ und Verfasserin des „S.C.U.M Manifesto“ – erstere schwarz, letztere lesbisch, im Gespräch erwähnenswert – lässt Zaimoglu zehn Frauen zu Wort kommen, die sich in Monologen weigern, sich „zur Assistenzfigur von Männern machen zu lassen“. Zaimoglu liest Brunhild, die kraftvolle, die intellektuelle, die – so Zitat Zaimoglu – „auf der blöden Burg“, mit den Nibelungenbrüdern „einer blöder als der andere“, ihren Mutterpflichten wegen zur Selbstverleugnung gezwungen ist.
Die Situation ist zeitlos und allgegenwärtig, ebenso die Wut, die durch ihren Monolog rast, die sie zur Verbalfurie macht. Zaimoglu liest sie mit rauchiger Stimme. Die Sprache ist geschraubt, archaisch und derb. Die Nibelungen „wispern, das Weib kam über uns“ und „du atmest durch deine feuchte Scham Walküre“. Brunhild sieht, „an den Decken hängen die säugenden Nachtvögel“. Zum Anliegen der Frau schafft der Ton Unschärfe und Distanz. Unklar ist auch, warum das „feministische Manifest“, in den vorgelesenen Passagen zumindest, die Frau ausschließlich über Männer reden, nachdenken, toben und lamentieren lässt, anstatt dass eine vom Mann losgelöste Neubestimmung stattfindet. Wenn Frauenmöglichkeiten diskutiert würden, wäre der Schriftsteller-Mann dann nicht viel feministischer?
Warum durch alle Jahrhunderte diese „sperrige“, „höchstgeschraubte Sprache“, fragt Wasner. Auch andere Erzähler seien in Frauenrollen geschlüpft – Flaubert, Fontane, Moravia -, hätten versucht zu verstehen, in welche Situation eine Rolle die Frau bringt. Mit Worten der heutigen Zeit könnten seine Frauen nicht sichtbar gemacht werden, verteidigt sich Zaimoglu. Von Frauen werde er übrigens weniger harsch kritisiert als von Männern. Und: „Die deutsche Sprache ist so mächtig, ich kann und kann nicht verstehen, warum man sich dieser Mittel nicht ermächtigt“. (für Allgemeine Zeitung Mainz, April 2019)
Buchcover: Kiepenheur & Witsch
Bild: OTS